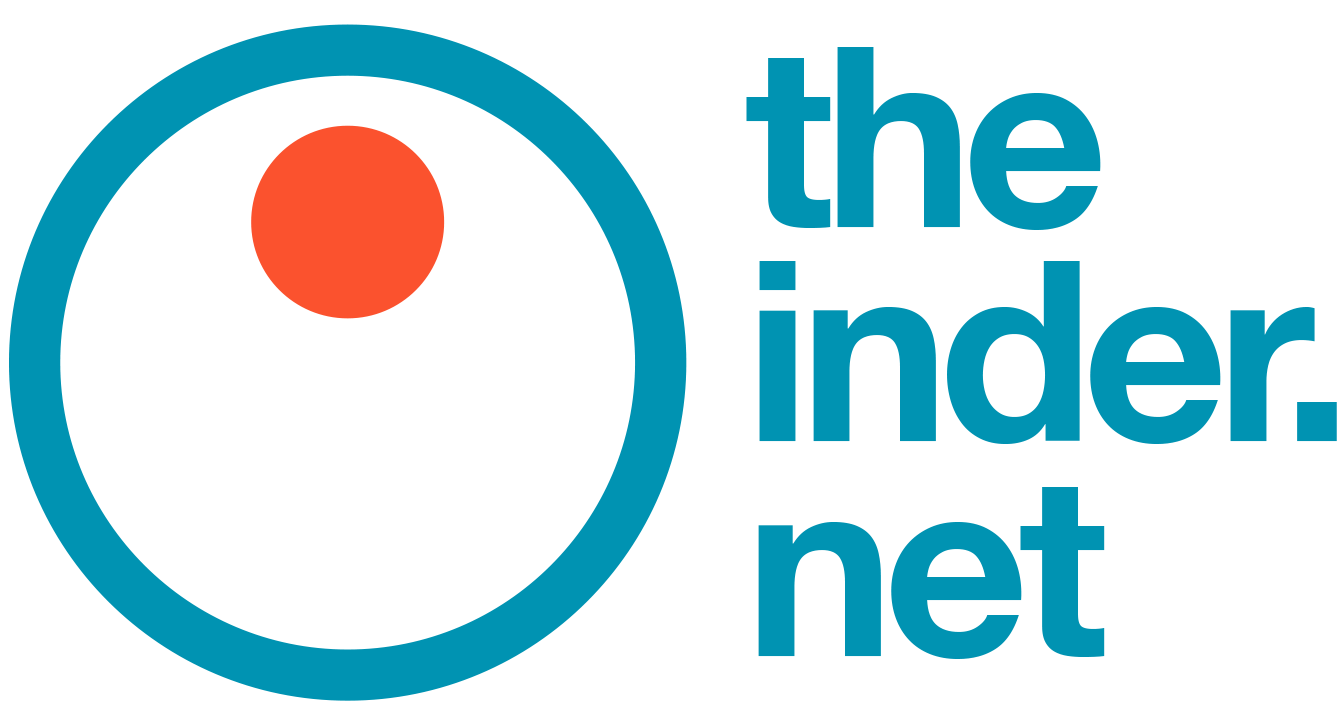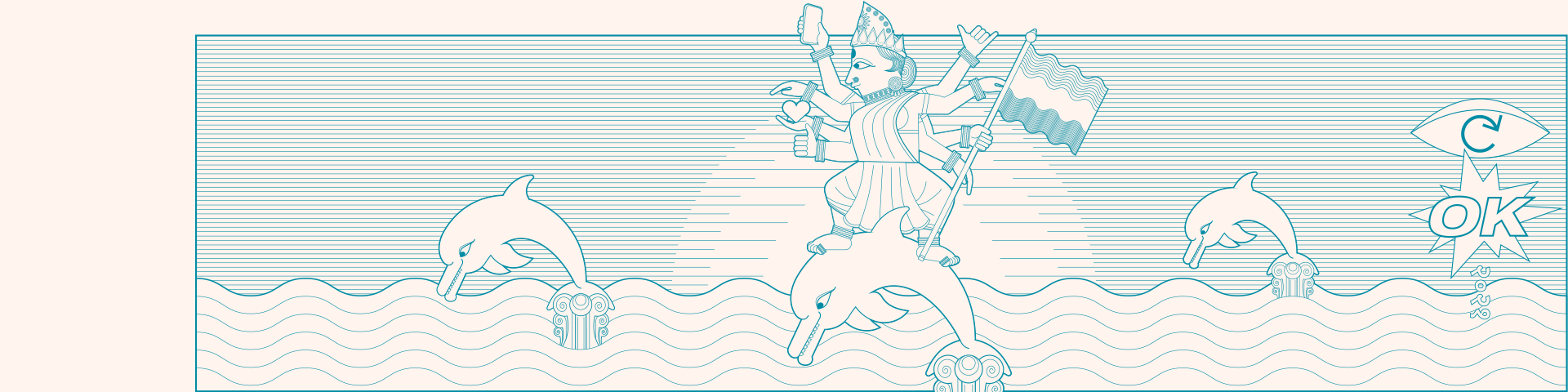Sandra Chatterjee ist gebürtige Münchenerin und ausgebildet in klassischem indischen Tanz: Bharatnatyam, Kuchipudi und Odissi. Die Berufsbezeichnung Tänzerin und Choreographin gefällt ihr demnach gut, hinzu kommt ihre wissenschaftliche Tätigkeit auf diesem Fachgebiet. Vor 16 jahren gründete sie mit Freunden das transnationale „Post Natyam Kollektiv“, einem Hort der kulturellen Kreativität. Wir wollten mehr über Sandras Arbeit erfahren und wie Tanz Kulturen verbinden kann. Darüber hinaus erfahren wir Interessantes aus ihrem Leben zu Migration, Stereotypen und Erfahrungen, die sie in den USA gemacht hat.
Sandra, Du bist Tänzerin und Choreographin. Ist das korrekt umschrieben?
Tänzerin und Choreographin trifft es gut, das mache ich schon am längsten und beschreibt meine Leidenschaft am besten. Wichtig ist mir aber auch die wissenschaftliche und organisatorische Arbeit, d.h. ich schreibe (wissenschaftlich) vorwiegend über Tanz und Performance und organisiere/produziere auch Projekte und Events, wie z.B. vor einigen Jahren mit Roman Chowdhury, den ihr ja auch interviewt habt und weiteren Freund*Innen von Munich Masala zusammen das „ArtSensasian Festival“, danach für ein paar Jahre die „integrier-Bar“ in München mit Peter Pfaff, und derzeit „CHAKKARs-moving Interventions“ mit Sarah Bergh.
Was ist eigentlich das „Post Natyam Collective“?
Das Post Natyam Kollektiv kombiniert alle der drei Tätigkeitsbereiche, die ich zuvor genannt habe. Wir sind eine transnationales Kollektiv, feiern auch diesen Monat Geburtstag – und zwar den 16.!
… Glückwunsch!
… danke (lacht). Wir lernten uns alle in Los Angeles kennen, arbeiten aber seit über 10 Jahren online an sogenannten „online creative processes“ – wir wählen meist ein Thema, mit dem wir uns über längere Zeit befassen: wir stellen uns gegenseitig Aufgaben und Fragen – die darauf basierenden „Antworten“ oder „Studies“ teilen wir dann wieder miteinander und geben uns gegenseitig Feedback. Aus der Materialsammlung entstehen dann Performance, Artikel, Workshops, oft jeweils dort, wo wir leben. Derzeit sind die Mitglieder Shyamala Moorty (Long Beach, CA, USA), Cynthia Ling Lee (Santa Cruz, CA, USA) und ich.
Huch, einen Doktor hast Du ja auch noch gemacht, was war Dein Thema und was kam dabei heraus?
Ja stimmt, in „Culture and Performance“ (also Kultur und Performance-Wissenschaft) mit Schwerpunkt Tanz. In meiner Dissertation habe ich über südasiatische diasporische Performances in Kalifornien geschrieben (nicht spezifisch Tanz, sondern auch Theater, Performance/Stand-Up/Spoken Word). Ich habe analysiert wie Weiblichkeit/Femininität/der weibliche Körper dargestellt wird, vor allem in Performances, die nicht die traditionellen Werte der Heimat, die die Eltern (in der Vergangenheit) verlassen haben, unkritisch reproduziert. Ein gutes Beispiel ist hier ein Community Theater Projekt, das 2003 an der University of California, Berkeley begann und unter dem Titel „Yoni Ki Baat“ eine südasiatische Version von Eve Enslers berühmten Vagina Monologen gewagt hat.
Du hast ja den klassischen indischen Tanz von der Pike auf gelernt, wie man so sagt. Erzähl uns doch etwas darüber.
Tatsächlich habe ich klassischen indischen Tanz intensiv gelernt – wenn auch in einer ungewöhnlichen Konstellation, in München, lange Zeit als einzige Schülerin meiner Lehrerin Ranga Vivekanandan-Barth. Sie unterrichtete Kuchipudi, eine nicht so bekannte klassische Tanzform, die ich selbst gar nicht kannte, bevor ich anfing sie zu lernen. Ich wollte einfach klassischen Tanz lernen, aber in München gab es zu der Zeit kaum LehrerInnen. Ich hatte schon ein Jahr Bharatanatyam Unterricht, aber mein Lehrer Arup Ghosh zog zurück nach Indien und Ranga Vivekanandan-Barth war gerade nach München gekommen und dann machte ich eben mit Kuchipudi weiter.
Wie häufig hast Du das pro Woche praktiziert?
Zunächst 1-3 Mal die Woche, bald schon jeden Tag, direkt nach dem Mittagessen ging ich zu meiner Lehrerin. Ich habe dadurch ungeplant in einem sehr traditionellen und intensiven LehrerIn-Schüler*In – Verhältnis die Grundausbildung gemacht, und im Alter von 16 Jahren meine Debutperformance (Rangapravesam) absolviert. Das war eine große Herausforderung, nicht nur körperlich durch das Training: ich lebte ja praktisch zwei Leben – Gymnasium und Tanzausbildung – und damit auch zwei kulturelle Kontexte. Seither unterrichte und performe ich. Während ich in Los Angeles lebte, tanzte ich dann wieder Bharatanatyam; mit Malathi Iyengar, künstlerische Leiterin der Rangoli Dance Company.
Also Bharatnatyam und Kuchipudi…
Ja, aber mein größter Wunsch war immer Odissi, eine weitere klassische indische Tanzform, zu lernen – das war da wo ich lebte (egal wo) aber immer schwierig. 2009 begann ich in Delhi bei Sharon Lowen Unterricht zu nehmen, aber bald schon nur sporadisch, weil sich dann mein indischer Lebensmittelpunkt von Delhi wegverschoben hat. Dass aufgrund der derzeitigen Pandemie Aktivitäten Kurse nun online stattfinden, hatte zur Folge, dass ich nach langer Pause nun über einen mehr-monatigen Zeitraum regelmässig (also 3-4 Mal die Woche) Unterricht in Odissi vertiefen kann. Und das schönste daran ist – ich kann Odissi ganz für mich geniessen – ich muss nicht mehr das Ziel vor Augen haben, irgendwann als Odissi Tänzerin auftreten zu wollen. Ich schliesse es nicht aus aufzutreten, aber geniesse das Lernen von Odissi – und seiner ganz spezifischen Technik und Koordination – in erster Linie für mich.
Das ist sicherlich ein Luxus, den man sich erlauben darf, es allein für sich selbst zu tun. Ist es richtig, dass Du indischen Tanzstile mit anderen aus der Welt kombinierst? Wenn dem so ist, wäre das nicht ein gutes Beispiel für Multikulturalität in der Tanzkunst? Wenn nein, warum müssen Tanzstile voneinander isoliert werden?
Ich bin nicht der Meinung, dass Tanzstile voneinander isoliert werden müssen – das geht für mich gar nicht – also zumindest wenn ich tänzerisch/choreographisch etwas eigenes kreiere. Wenn ich allerdings Kuchipudi oder Bharatanatyam unterrichte (oder performe, das ist mittlerweile aber sehr sehr selten), oder aber wie derzeit Odissi lerne, dann kommt es schon darauf an, die Stile und Formen voneinander unterscheiden und isolieren zu können. Bei meinen eigenen Choreographien und Improvisation fliesst mein gesamtes tänzerisches Wissen ein – und lässt sich auch nicht voneinander trennen. Ich würde das allerdings nicht Multikulturalität nennen. Die kombiniere oder stelle die Tanzformen in diesen Fällen nicht bewusst nebeneinander, sondern lasse es zu dass die Tanzsprache, die sich aus meiner TänzerInnenbiographie ergibt äussern kann. Eine ganz große Rolle spielt dabei polynesischer Tanz, den ich in meinen 4 Jahren in Honolulu lernen durfte (Hawaiianischen Hula und Tahitischen Tanz), aber auch Salsa und Bachata sind ein Teil dieser TänzerInnen Biographie, wie auch Training in Ballet, modernen, postmodernen und zeitgenössischen Tanztechniken.
Wir wechseln elegant das Thema… Ich interessiere mich für Deine Blickweise auf die 2. Generation der in Deutschland lebenden Inderinnen und Inder, Du hast u.a auch im Buch „Inderkinder“ mitgewirkt. Wie lautet die Migrationsgeschichte Deiner Eltern, wie bist Du aufgewachsen, unter dem Gesichtspunkt zweier Kulturen?
Mein Vater kam Ende der 1950er Jahre – sehr jung – von Asansol, einer Kleinstadt in Westbengalen nach Deutschland. Meine Eltern lernten sich in München kennen, wo meine Mutter aufgewachsen ist. Ich selbst bin in München geboren und aufgewachsen – mit meiner Mutter, meinem Vater und meiner deutschen Großmutter. Leider ist mein Vater früh verstorben: ich war gerade 11. Wir sind regelmäßig nach Asansol gefahren – zunächst alle 2 Jahre, dann jedes Jahr und haben den Sommer dort verbracht – ich habe die Kindheit dort sehr genossen, mit Cousinen und FreundInnen, und wollte eigentlich schon damals nie zurück nach München – der Zwiespalt war, dass meine Großmutter ja allein hier war!
In Gesprächen mit vielen „Inderkindern“ ist die Identitätsfrage stets sehr präsent, das merke ich auch an mir selbst. Was hast Du geantwortet oder für Dich verarbeitet, wenn Du gefragt wurdest, als was Du Dich fühlst?
Das ist eine wirklich schwierige Frage…
Nisa konnte sie auch nicht klar beantworten – und wahrscheinlich kann man das auch gar nicht?
(lacht)… ich merke, dass ich schon sehr sehr lange nicht mehr darüber nachgedacht habe! Wenn ich allein für mich bin, ist es ja auch wenig relevant, ob ich mich jetzt deutsch, indisch oder sonst wie fühle…
… das stimmt wohl.
In der gesellschaftlichen Interaktion dominiert tatsächlich bei der Frage des Deutsch-Seins das ständige Gefühl nicht adäquat dazuzugehören – nicht deutsch genug zu sein – lange Zeit auch und vor allem im Kunst – und Kulturbetrieb, wobei sich da in den letzten Jahren doch einiges bewegt hat.
Im Buch „Inderkinder“ hast Du eine interessante Anekdote erzählt: Obwohl Du die Einführung einer Tanzvorführung auf Deutsch machtest, wurdest Du abschließend von Zuschauer/innen auf English befragt. Dein Aussehen als indische Tänzerin schien Dich automatisch in eine Schublade gesteckt zu haben. Schubladendenken, ein typisch deutsches Phänomen?
Ja die Anekdote beschreibt pointiert eine Erfahrung, die ich auf unterschiedliche Weise über Jahre hinweg regelmäßig machen musste, dass die die Tatsache, dass ich auch z.T. ‚deutsch‘ bin, entweder nicht wahrgenommen wird oder aber ich aufgefordert wurde es auf der Bühne nicht preiszugeben, um die Illusion nicht zu zerstören.
… und dabei ist man doch das, was man ist!
… ob das allerdings typisch deutsch ist kann ich so genau nicht einschätzen, denn visuelle Zuschreibungen spielen eine große Rolle darin wie wir wahrgenommen werden, im Alltag und auf der Bühne, in Deutschland und darüber hinaus. Es ist eine problematische Frage, über die ich viel nachdenke – den Zusammenhang zwischen Tanztechnik und kultureller Herkunft (v.a. auf der Bühne).
Ein weiteres Dilemma wie ich finde ist, dass es für Einheimische in Indien auch ein Problem zu geben scheint. Wurdest Du in Indien darauf angesprochen, woher Du denn kommst und ob Du Inderin seiest?
Manchmal passiert das schon, aber mittlerweile eher selten. Auch lebe ich schon seit einigen Jahren immer wieder in Indien – und verbringe – auch in den Zeiten, wo ich schwerpunktmäßig hier arbeite – jedes Jahr viele Monate in Indien …. Indien ist einer meiner Lebensmittelpunkte. Seit ich dort eigenständig (also abseits meiner Familie) vernetzt und verortet bin, passiert mir das tatsächlich seltener. Ich bin nicht mehr die deutsche Cousine, die im Sommer zu Besuch kommt und aus dieser Perspektive Indien erfährt.
Manchmal wird mir schon die Frage gestellt, ob ich wirklich aus Indien bin, z.B. wegen unzureichender Sprachkenntnisse, vor allem nach längerer Abwesenheit. Aber ich habe mein Leben und meine gewachsenen (Infra)Strukturen und eine sehr engen Freundes und (Wahl-)Familienkreis – daher fühle ich mich schon sehr zu Hause – vor allem in einer heterogenen Stadt wie Neu Delhi mache ich persönlich diese Erfahrung selten. Im Gegenteil, wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin, die Gurkha ist (aus Darjeeling), wird mein „Indisch-sein“ wesentlich seltener in Frage gestellt als ihres.
Interessant. Genau hier müsste man als junger Mensch doch ins Straucheln kommen und sich verunsichert fühlen, wer oder was man denn nun sei…
Stimmt, als ich jünger war, und vor allem bevor ich meinen eigenständigen Bezug zu Indien entwickelt hatte (und immer als die „deutsche Cousine“ zu Besuch kam) war das viel schwieriger. Meine Reaktion nach dem Abitur war eine Art Weglaufen – ich wollte unbedingt an einen Ort ziehen, der weder Deutschland noch Indien ist, um diesem Zwiespalt zu entgehen. Und endete schließlich – eher durch Zufall – in Honolulu (eigentlich wollte ich nach London).
Das Wetter ist da deutlich besser…
(lacht) Ja! So verbrachte ich schliesslich ca. 12 Jahre in den USA, und das war fantastisch, auch mit Hinblick auf Identitätsfindung und meine künstlerische Entwicklung. Leider ist es aber so, dass zumindest nach aussen hin, meine eigenen Migrationserfahrungen bei der gesellschaftlichen Einordnung als Person mit „Migrationshintergrund“ keine wesentliche Rolle spielen. Der Begriff ist sehr problematisch und einseitig besetzt.
Dazu kommen wir gleich noch kurz. Vielleicht noch: Kannst Du mit Deinem Tanz Stereotypen aufbrechen? Welche Akzente kannst Du mit einer Kunst wie Deiner setzen? Jeder Künstler möchte mit dem was er tut, mit Sicherheit etwas zum Ausdruck bringen?
Die ersten 10 Jahre meiner zeitgenössischen choreographischen Tätigkeit waren stark davon geprägt, gegen Stereotypen anzutanzen (und auch das Thema meiner Dissertation befasst sich damit: was bedeutet es, sich als indisch-aussehende Frau auf der Bühne zu bewegen?). Besonders wichtig war dabei Exotismus, und wie exotifizierende Blicke und Rezeptionen mich als Tänzerin geprägt haben, und wie ich sie herausfordern kann. Über die Jahre hat sich mein Fokus etwas verschoben, aber ich will immer noch ganz spezifische Impulse setzten. Mir geht es immer mehr um direkten Austausch mit dem Publikum in partizipativen/installativen Performances…
Wie funktioniert das?
Indem das Publikum nicht sitzt, sondern sich frei im Raum bewegt und sich auf verschiedene Arten und Weisen mit dem Thema, das ich bearbeite, auseinandersetzten kann: Dinge ansehen, lesen, hören, neben den tänzerischen Performances. Seit einiger Zeit beschäftige ich mit mit Düften und Gerüchen und plane dazu gerade ein Projekt.
Sehr innovativ! Lass uns einen Punkt zum Thema Jugendszene machen: theinder.net wird in diesem Jahr 20, hurra, und auch die deutsch-indische Jugendszene ist nun 20-25 Jahre alt, hast Du sie mit verfolgt und wie betrachtest Du die Entwicklung?
Das ist fantastisch! Ich gratuliere Euch – auch für Euer Durchhaltevermögen! Eine solche Initiative aufrechtzuerhalten bedarf viel Ausdauer und Commitment! Ich habe ja die Anfangszeiten vor Ort verpasst, weil ich in den USA war – und in den Semesterferien dann schon regelmäßig bei Munich Masala. In Kalifornien ist die indische/südasiatische Diaspora ja viel größer und ist schon länger organisierter – vor allem künstlerisch habe ich dort viel dadurch gelernt und gewonnen und es auch hier zeitgleich als sehr schön empfunden, dass sich Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin neu zusammen gefunden haben. Was interessant ist, dass ja Migration aus Indien merklich zugenommen hat – und dies natürlich auch die Szene verändert. In München ist das spürbar. Allerdings ist das schon eine ganz andere „Szene“ als die der zweiten Generation, die hier aufgewachsen sind.
Ja, das ist schon sehr unterschiedlich, die Motivationen sind andere.
Und hier stellen sich auch viele neue Fragen des Zusammenseins. Spannend find ich auch – abseits von der deutsch-indischen/südasiatischen Community Zusammenschlüsse von BPoC (Black/People of Color) in Deutschland, vor allem in anti-rassistischen Initiativen. Dies ist für mich als Künstlerin sehr sehr wertvoll und spannend, eine immer sichtbarere „postmigrantische“ Künstler*Innen Szene zu erfahren.
Wie sieht die Zukunft junger Menschen mit „Migrationshintergrund“ – ich mag diesen Begriff nicht – in Deutschland aus, wie sollte sie aussehen, wenn wir auf die nächsten Generationen schauen, vor allem den Rechten entgegenwirken können?
Ich mag den Begriff auch nicht. Die Frage der nächsten Generation ist auch wieder eine schwierige Frage. Noch vor 5 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass die Welt sich dahin entwickeln könnte, wo wir jetzt sind. Mir fällt wirklich schwer darauf eine Antwort zu finden, da ich derzeit schon sehr desillusioniert bin. Wünschenswert wäre natürlich, dass sich die Situationen mehr in Richtung „equity“ bewegt – weltweit und hier – „equal access“ (es ist bezeichnend dass mir deutsche Begriffe dazu fehlen, oder bin das nur ich, weil ich im Alltag viel auf Englisch funktioniere?).
Aber ich würde mir vor allem wünschen, dass wir, wenn wir über eine Zukunft nachdenken, diese im Sinne der globalen Gerechtigkeit sehen, während wir gleichzeitig weiterhin lokale Probleme angehen und zu verbessern suchen.
Einen besseren Schlusssatz kann es hier nicht geben. Danke, dass Du Dir die Zeit für ein Gespräch genommen hast.
Link: www.sandrachatterjee.net